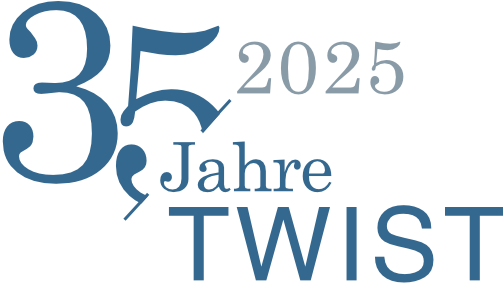Zepterübergabe
Emotionen im Prozess der Zepter-Übergabe in Unternehmen
Wie kann eine Übergabe der Verantwortung vom (Ex-)Chef auf seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin auch psychisch für beide Protagonisten gut gelingen?
Autorinnen: Claudia Harss, Sonja Nitsch
Zahlreiche Veröffentlichungen und Ratgeber zur geregelten Nachfolge einer Führungsposition bieten Orientierung, auf was geachtet werden muss, damit ein möglichst reibungsfreier Generationswechsel gewährleistet ist (z.B. Sobanski & Gutmann, 1998). Wie kommt es dann, dass sowohl Vorgänger als auch Nachfolger über so heftige Gefühle berichten, denen sie in der Phase einer Zepter-Übergabe oft monatelang ausgesetzt sind? In Interviews und einem Workshop mit 25 Kunden und Beratern machten sich die Autorinnen im Juli 2025 auf die Suche nach konkreten Situationen, die im Übergabeprozess der Verantwortung starke Emotionen bei einem der Protagonisten auslösten. Sie leiten hieraus Spielregeln für einen auch psychisch gelungenen Übergangsprozess ab. Diese bieten Anregungen für Betroffene und begleitende HR – Experten.




Zepter-Übergeber und Zepter-Empfänger
Nachgefragt im Übergabeprozess
Im geschützten Raum von Coaching-Sitzungen wird deutlich, dass die Übergabe von Macht und Verantwortung sowohl für Nachfolger als auch Vorgängerin emotionale Herausforderungen mit sich bringt. Dies gilt vor allem für eine Übergangsphase, in der beide Akteure zugleich in derselben Organisationseinheit tätig sind. Trotz einer Vielzahl an Publikationen zum Thema Führungswechsel gehen wenige Autoren explizit auf diese spezifische Situation und deren emotionale Herausforderungen ein und beziehen sich dabei meist auf Familienunternehmen (z.B. Maurice, 1993; Stonn, 2008; Gerke Holz Häuer, 2013; Lemar, 2014).
Obwohl systemisch betrachtet von einem Führungswechsel ein größerer Kreis von Personen betroffen ist, fokussieren wir uns in diesem Beitrag auf die beiden Hauptakteure Vorgänger und Nachfolger. Wir betrachten konkrete Alltagssituationen im Übergabeprozess der Verantwortung (symbolisch „das Zepter“) und die dabei beiderseits auftauchenden Emotionen. Um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern, verzichten wir dabei auf die Form des Genderns und benutzen mal die feminine, mal die maskuline Umschreibung.
Die Relevanz des Themas wurde uns klar, als wir Test-Interviews mit elf Führungskräften führten, die bereits eine Zepter-Übergabe aus einer der beiden Perspektiven (Vorgängerin oder Nachfolgerin) erlebt hatten: Unsere Gesprächspartner wurden emotional, wenn sie sich an das Verhalten ihres Vorgängers oder ihrer Nachfolgerin während der Übergangsphase erinnerten. In einem Workshop „Zepter-Übergabe“ mit 25 Kunden und Beratern im Juli 2025 widmeten wir uns daher nochmals vertieft dem Thema. In zwei Gruppen, die sich jeweils an persönliche Erlebnisse in der Rolle des Vorgängers oder Nachfolgers erinnerten, sammelten wir zum Einstieg kritische Situationen, die im Übergabeprozess (oft heftige) Emotionen bei einem der beiden Protagonisten „getriggert“ hatten. Dabei nannten sowohl Vorgänger als auch Nachfolger spontan häufiger Situationen, die negative Emotionen ausgelöst hatten.
Interessant war dabei vor allem, dass das Gefühl der Ohnmacht bei beiden Protagonisten gleichermaßen prominent war. Selbstbewusst und sicher fühlt sich demnach offenbar weder die Noch-Chefin noch deren Nachfolgerin in der Übergangsphase. Zugleich gingen beide Seiten implizit davon aus, der oder die Andere fühle sich übermächtig.
Die Sicht der Nachfolgerin
„Du hältst mich klein!“
Die Trigger-Situationen, die bei der Nachfolgerin in der Interaktion mit dem Vorgänger starke Emotionen ausgelöst hatten, lassen sich folgenden fünf Themenblöcken mit zuordnen:
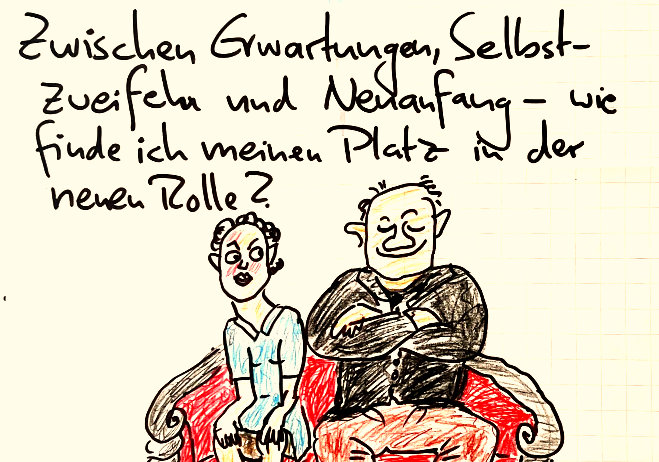
- Der Vorgänger kann oder will nicht loslassen, z.B.: „Lassen Sie mich zur Sicherheit alle Angebote nochmals lesen!“
- Offiziell auf Augenhöhe – aber immer noch Vorgesetzten-Verhalten, z.B.:„An seinem Verhalten mir gegenüber änderte sich nach meinem Aufstieg in den Kreis der Abteilungsleiter nichts. Er meinte vor allen Kollegen zu mir: Sie machen uns dann bitte ein Protokoll bis nächste Woche, Frau X!“
- Überfordernde Ad-hoc-Einsätze, z.B.: Mein Chef wurde krank und beauftragte mich, sie in zwei Tagen (!) bei einer Konferenz in London zu vertreten. Ohne ausreichend Zeit mich einzuarbeiten flog ich los und machte ganz und gar keine glückliche Figur als künftige internationale Ansprechpartnerin für Deutschland.“
- Mach Du… und dann macht er es doch wieder selbst, z.B.: „Du bist im Lead! – so mein Vorgänger. Von wegen! Nach 15 Minuten, ich steckte mitten in der Präsentation, kam eine Frage des Kunden. Danach redeten nur noch die beiden. Ich stand wie bestellt und nicht abgeholt am Beamer.“
- Subtile Konkurrenz und Dominanzverhalten bis zum Schluss, z.B.: „Die letzten Wochen, als mein Vorgänger noch da war, haben wir uns einen latenten Machtkampf geliefert: Wer hat das letzte Wort? Wer sitzt auf welchem Stuhl? Wessen Idee setzt sich durch? Wer darf das Meeting eröffnen oder ein Meeting für beendet erklären?“
Die Gefühle, welche die jeweiligen Situationen ausgelöst hatten, offenbarten das Gegenteil von dem, was man sich unter dem Stichwort „Empowerment“ an Motivation und Stärkung für eine Nachfolgerin erhoffen würde:
- Sich klein gehalten fühlen: Wie soll ich neben diesem Riesen-Ego jemals Fuß fassen? Der traut mir offenbar gar nichts zu! Bin ich wirklich so unfähig?
- Ohnmacht und Hilflosigkeit sowie das Gefühl, ausgeliefert zu sein, solange der Vorgänger am längeren Hebel sitzt und das letzte Wort für sich beansprucht.
- Demütigung, wenn man vor Dritten wie ein Hiwi behandelt oder in die Schranken verwiesen wurde.
- Angst zu versagen bis hin zur Panik, den Erwartungen nicht gerecht zu werden und keine Fehler machen zu dürfen, um den Vorgänger nicht zu enttäuschen.
- Sich erschöpft, ausgenutzt und veräppelt fühlen, wenn man längst „den Laden schmeißt“ und der Vorgänger sich dafür feiern lässt.
- Überstrapazierte Geduld und Zorn: Der lässt mich niemals machen! Am 31.12. sollte ich das CEO-Büro übernehmen, aber als ich im Januar aus dem Skiurlaub komme, hockt er immer noch drin und meint: „Sie haben doch nichts dagegen? Mein Beratervertrag läuft ja noch bis März!“
- Ambivalenz, wenn man sich ein längst überfälliges Feedback an den Vorgänger ein ums andere Mal verkneift, weil man die Hand, die einen lange gefüttert hat, nicht beißen will.
Die Sicht des Vorgängers:
„Du machst mich klein!“
Ein Blick auf die Trigger-Situationen aus Sicht der Vorgänger offenbart, dass auch die „Noch-Zepter-Inhaber“ sich im Übergabeprozess keineswegs so mächtig fühlen, wie man meinen könnte. Typische Trigger-Situationen lassen sich auch hier fünf Themenblöcken zuordnen:
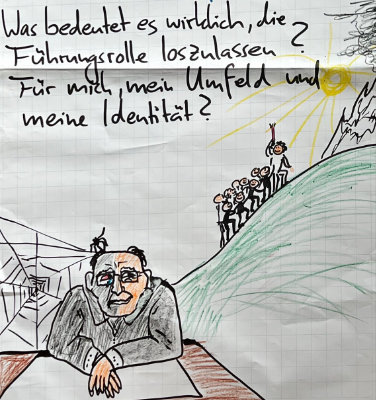
- Wissen und Erfahrung der Vorgängerin werden nicht erfragt, z.B.: „Als der Pitch neulich in die Hose ging und ich die Begründung des Kunden hörte, dachte ich: Das wäre vermeidbar gewesen – warum habt Ihr mich nicht gefragt oder vorher einbezogen?“
- Die Nachfolgerin schmückt sich mit fremden Federn, z.B.: „Sie hat das ganze Projekt so dargestellt, als sei es auf ihrem Mist gewachsen und mich kein einziges Mal erwähnt, obwohl ich Initiator und vier Jahre treibende Kraft des Projektes war!“
- Unterschiedliche Vorstellungen zum Herangehen, z.B.: „Wir kommen in manchen Punkten bei der Herangehensweise nicht zusammen und die Mitarbeitenden sagen auch nicht ehrlich ihre Meinung, weil sie es sich mit keinem von uns verscherzen wollen.“
- Indirekte Hinweise – Du bist von Gestern, z.B.: „Das macht man heute anders!“ „Was, das kennst Du noch nicht?“ „Soll ich Dir´s machen, damit es schneller geht?“
- Latente oder offene Abwertung der Arbeit des Vorgängers, z.B.: „Bei ihrer Antrittsrede meinte meine Nachfolgerin coram Publico, es sei ja in der Vergangenheit einiges liegen geblieben, was sie nun endlich angehen wolle!“
Bei den befragten Vorgängern macht es Sinn, zu unterscheiden, ob ein weiterer Karriereschritt oder das Ende des Berufslebens anstehen. Im ersteren Fall überwiegen häufiger aggressive, im zweiten Fall dagegen depressive Gefühle, wie die folgenden Beispiele zeigen:
- Konkurrenz, Aggression und Überempfindlichkeit, wenn der Platz, der einem bislang zustand, (gefühlt) allzu früh und fordernd von der Nachfolgerin beansprucht wird.
- Ärger über vermeidbare Fehler, die nicht passiert wären, wenn die Nachfolgerin nicht leichtfertig losgelegt, sondern lieber mal gefragt hätte.
- Enttäuschung und Wut, wenn über Dritte kolportiert wird, dass man aus Sicht der Nachfolgerin an allem, was in der Vergangenheit schlecht lief, die Hauptschuld trägt.
Vor allem bei denjenigen unserer Befragten, die das Zepter endgültig vor der Rente übergeben hatten, stand das Gefühl, ausrangiert und abgewertet zu werden, im Vordergrund:
- Gefühlte Abwertung, Macht- und Bedeutungslosigkeit durch fehlende Wertschätzung der Leistung des Vorgängers durch die Nachfolgerin.
- Kränkung, wenn man nicht mehr eingeladen oder auf dem Verteiler bedacht wird, Mails tagelang nicht beantwortet werden oder vergebene Aufträge eine geringe Priorität haben.
- Langeweile und das Gefühl der Nutzlosigkeit, wenn eine Aufgabe nach der anderen ersatzlos übergeben wurde.
- Sorge, dass die Dinge ohne einen schlechter laufen, Projekte an die Wand fahren und Kunden oder wichtige Leistungsträgerinnen abspringen.
- Trauer über den Abschied von der gewohnten Arbeit, dem Team und langjährigen Weggefährten.
- Angst, Selbstzweifel und Orientierungslosigkeit verbunden mit dem Gefühl, noch nicht am neuen Platz oder in der neuen Lebensphase angekommen zu sein und sich plötzlich schwach zu fühlen, wo man sich doch bislang immer nur stark kennt.
Der lohnende Blick auf verborgene Bedürfnisse hinter der Emotion
Um im Workshop die Kurve hin zu einer konstruktiven Lösung in all den eher negativen Emotionen zu finden, fragten wir, welche eigenen Bedürfnisse in der jeweiligen Trigger-Situation auf der Strecke geblieben waren. Obwohl Vorgängerinnen und Nachfolger in unserem Workshop und den Interviews getrennt befragt worden waren, kamen hier sehr ähnliche Antworten:
Das Bedürfnis nach Empathie, Respekt und einem wertschätzenden Umgang, der Wunsch, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und gebraucht zu werden sowie das gegenseitige Vertrauen, sich auf getroffene Vereinbarungen verlassen zu können. Bei den Nachfolgern kam das Bedürfnis hinzu, eigene neue Ideen und Wege ausprobieren zu dürfen – ohne unnötige Einschränkungen oder übergroße Angst vor Fehlern.
Interessanterweise wurden viele unserer Teilnehmer nachdenklich bei der Frage nach eigenen Bedürfnissen, die sich in den Trigger-Situationen hinter den negativen Emotionen verbargen. Im Workshop entspannte sich die Atmosphäre und wurde merklich ruhiger und konstruktiver. Es ging jetzt nicht mehr primär um Selbstbehauptung, sondern um Selbstfürsorge. Dies war wichtig, um im folgenden Schritt zu reflektieren, wie man aus heutiger Sicht sein Bedürfnis hätte besser anmelden können: Fast alle Befragten gaben an, sie würden mit Abstand betrachtet weniger dem Impuls folgen, sofort aggressiv oder mit gekränktem Rückzug zu reagieren. Rückblickend wäre es in den meisten Fällen besser gewesen, erst zu reflektieren und dann in einem offenen Gespräch auf Augenhöhe das eigene Bedürfnis ehrlich anzumelden.
Ergebnisse
Tipps und Spielregeln für Betroffene und Personalexperten
Im letzten Schritt des Workshops wurden Spielregeln und Tipps erarbeitet, die auch Anregungen an Personalabteilungen und externe Berater einschlossen.
Was Vorgängerinnen beachten können:
- Loslassen lernen: Ein Abschied von der gewohnten Vorgesetzten-Rolle kann emotional herausfordernd sein. Im inneren Change-Prozess kann es helfen sich zu erinnern, wann und wie man einen Ablöseprozess bereits einmal gut gemeistert hat.
- Klare Spielregeln und ein Zeitplan: Vereinbare mit dem Nachfolger einen Zeitplan für die schrittweise Übergabe der Verantwortung sowie (auch für Dritte transparente) Regeln, wer bis wann für was Ansprechpartner ist, und halte Dich selbst daran!
- „Flexibilitätsgymnastik“ angesichts neuer Ideen und Herangehensweisen: Lass Dich auf neue Ideen des Nachfolgers ein, interessiere Dich wirklich dafür und stelle Fragen, bevor Du kritisierst oder die Neuerung reflexhaft ablehnst!
- Fehlertoleranz: Auch wenn Du vorerst offiziell noch in der Verantwortung bist, trau Dich, auch wichtige Aufgaben zu übergeben. Der Satz „Du machst das schon!“ stärkt und motiviert den Nachfolger sehr und schafft Vertrauen (auch nach außen).
- Trennung der Reviere auch symbolisch: Bleibe nicht in Deinem Chef-Büro, wenn die Nachfolge offiziell angetreten ist. Such Dir ein „Zuhäusl“, in dem man Dich aufsuchen und fragen kann, solange Du noch an Bord bist.
Ermutigung und Tipps für Nachfolger:
- Versuche, höflich und wertschätzend zu bleiben: Unsere Fallsammlung zeigt deutlich, dass die Vorgängerin oft ebenso verunsichert ist wie Du selbst. Wenn Du häufiger „wir“ als „ich“ denkst und sagst, machst Du es ihr leichter, Dir das Rampenlicht zu überlassen.
- Erst das Alte verstehen – dann Neuerungen einbringen: Stell sicher, dass Du verstanden hast, was die verborgene Logik und Historie bestimmter Abläufe anbelangt, bevor Du sie änderst.
- Realistische Erwartungen an Dich selbst stellen: Nimm Dir den Druck, alles sofort verstanden und bestens im Griff zu haben. Bezogen auf die neue Rolle bist Du Anfänger, wirst Fehler machen und darfst alle Fragen stellen, die Du hast.
- Raus aus der Mitarbeiter-Rolle: Behandle Deine Vorgängerin auf Augenhöhe. Sag ehrlich und höflich, wenn Du gerade keine Zeit hast oder bitte um kollegialen Rat, wenn Du Dich bei einer Aufgabe überfordert fühlst.
- Fordere die Vorgängerin als Begleiter und Coach: Wenn Du Dich fachlich und menschlich reif für die nächste Herausforderung fühlst, bitte explizit darum, die Vorgängerin bei wichtigen Aufgaben oder Gremien vertreten zu dürfen und Dir vorher Tipps zu geben.
Eine wichtige Erkenntnis aus den zehn Geboten liegt auf der Hand: Es macht Sinn, dass beide Protagonisten schon in der Übergabezeit des Zepters bewusst ihre gewohnten Rollen und die damit verbundenen Erwartungen an den Anderen aufgeben. Die gewohnte Rollenverteilung (Vorgesetzte einerseits, Mitarbeiter andererseits) passt in der Phase des Übergangs nicht mehr. Hilfreich ist dagegen das Leitbild eines Teams zweier verantwortungsbewusster Menschen, die auf Augenhöhe agieren und den Führungswechsel gemeinsam so gestalten, dass Mitarbeitende und Aufgaben auch in Zukunft optimal betreut sind.
Fazit für HR–Experten und externe Berater
„Der technische Aspekt der Zepter-Übergabe ist easy – der emotionale ziemlich vertrackt!“, resümierte der ehemaliger HR-Leiter eines Chemie-Konzerns im Twist-Workshop. Interne und externe Berater sind aufgefordert, diesen „blinden Fleck“ künftig mehr im Auge zu behalten. Sinn macht vor allem eine psychologisch fundierte Begleitung für beide Protagonisten und das betroffene Team im Übergabeprozess. Die Begleitung sollte einerseits logische Aspekte, wie den z.B. den Zeitplan, abdecken, andererseits aber auch die psychologische Seite der Nachfolge viel stärker berücksichtigen, indem die Erwartungen und Bedürfnisse der Beteiligten auf den Tisch kommen, zum Perspektivenwechsel ermutigt wird und gemeinsam Spielregeln für die Übergangszeit erarbeitet werden.
Am Ende sollte der Abschluss des Prozesses mit einer Feier „Zepter-Übergabe“ gewürdigt werden. Wird dabei ein symbolischer Gegenstand (z.B. der Schlüssel zur Firmenzentrale, das Chef-Büro) vor der versammelten Belegschaft übergeben, führt dies zu einem tiefen emotionalen Begreifen aller Beteiligten, dass eine Phase zu Enge geht und eine neue beginnt.
Für diejenigen Führungskräfte, auf die nach der Übergabe an die Nachfolgerin „der wohlverdiente Ruhestand“ wartet, ist das Loslassen oft besonders hart. Die Begleitung durch einen Coach, der bereits einige Monate vor der Rente dabei hilft, für die nächste Lebensphase sinnvolle Lebensinhalte und Aufgaben zu finden (Transition-Coaching), kann das Loslassen und Übergeben der Verantwortung für den Vorgänger spürbar erleichtern.
Abschließend stellt sich die Frage: Kann man sich nicht den ganzen emotionalen Stress sparen, indem die Nachfolgerin oder der Nachfolger erst dann auf die Bühne tritt, wenn der Vorgänger weg ist? Der Buchautor und Experte für Generationswechsel in Familienunternehmen Dr. Bernd Lemar, den wir hierzu befragten, nannte uns folgende Faustregeln: Je komplexer und erfahrungsabhängiger die Aufgabe, desto länger sollte naturgemäß die überlappende Anwesenheit von Vorgänger und Nachfolger sein. Wenn beide Protagonisten sich gut verstehen (und leider nur dann!), sei dies ein großer Vorteil für einen sehr guten Erfahrungs- und Knowhow-Transfer. Lemar meint nach fast 40 Jahren Beratungsarbeit: „Wenn man sich wirklich darauf einlässt, ist es eine sehr sinnvolle und erfüllende Aufgabe, einer begabten Nachfolgerin oder einem Nachfolger in den Sattel zu helfen!“